
Eisenhammer, Hasloch
Highlight 60
Produktion : 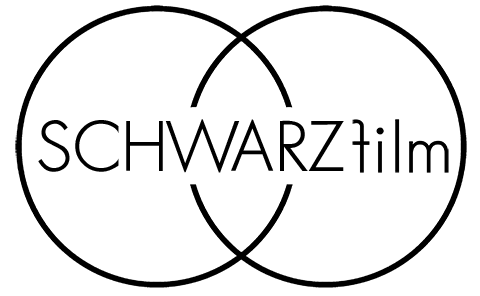 © 2025
© 2025


Produktion : 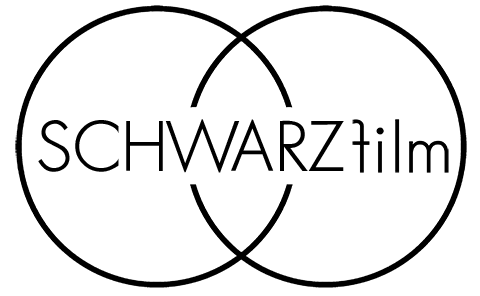 © 2025
© 2025

Die drei regierenden Grafen von Löwenstein-Wertheim stellen am 24. März 1779 den Brüdern Tobias und Johann-Heinrich Wenzel aus Neulautern einen Erbbestandsbrief zur Errichtung eines Eisenhammers aus. Daraufhin wird ca. 3 km nördlich von Hasloch ein Hammergebäude errichtet. Die Wasserversorgung wird über einen Wassergraben angelegt, dessen Wasser die oberschlächtigen Wasserräder antreibt.
Von den früheren vier Hämmern sind zwei erhalten: ein Aufwerfhammer und ein Schwanzhammer. Der Wellbaum des Hammerwerks ist ein Eichenstamm von etwa 9 m Länge und einem Durchmesser von 80 bis 90 cm. Die zwei weiteren an den gemeinsamen Wellbaum angeschlossenen Hämmer wurden früher für das Schmieden von Hacken und Hauen genutzt.

Mit den beiden funktionstüchtigen Aufwerf- und Schwanzhammer werden verschiedene Schmiedeteile produziert. Im Wesentlichen sind das Klöppel für Kirchenglocken, für die eine für Freiformschmieden ausserordentliche Präzision von ± 2 mm erreicht wird.
Der Aufwerferhammer wird durch das sich drehende Wasserrad über fünf auf dem Wellbaum befindlichen Nocken angehoben. Die Nocken rutschen durch und der Hammer - der Bär - fällt herunter. Sein Eigengewicht von 170kg verformt das auf dem Amboss liegende Eisen. Dieser Vorgang wiederholt sich mit jeder Nocke. Oberhalb des Hammerstiels verhindert der sogenannte Preller ein zu weites Aufwerfen des Hammers und verstärkt den Schlag durch die entstehende Federwirkung.

Der Schwanzhammer ist der kleinere Hammer mit einem Bärgewicht von 135 kg. Bei diesem drücken die Nocken auf den Schwanz des Hammerstiels und heben so den Hammerstiel. Der gusseiserne Kammring auf dem Wellbaum hat 14 eingekeilte Nocken, die eine schnelle Schlagfolge des Hammers erzeugen. 40.000 bis 50.000 Pflugschare wurden jährlich mit diesem Hammer produziert.
Die Wohnungen für die Hammerschmiede befinden sich über dem Hammerwerk. In der Blütezeit des Hammergewerbes waren hier 16 Hammerschmiede in Schichtarbeit beschäftigt.
Die Zeit der Eisenhämmer im Odenwald und Spessart fand im 19. Jahrhundert ihr Ende. Die Hochöfen im Ruhrgebiet verdrängen sie mit ihren moderneren Fertigungsmethoden.